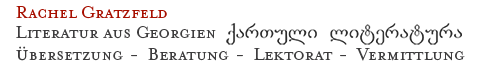Gela Tschkwanawa
Gela Tschkwanawa wurde 1967 in Sochumi (Abchasien) geboren. Nach Schulabschluss wurde er in die Armee eingezogen und kam zur Flieger- und Raketenabwehr in Leningrad. Nach dem Heeresdienst kehrte er nach Sochumi zurück und studierte Philologie. Noch vor Studienende begann der Abchasien-Krieg. Tschkwanawas Haus verbrannte, zusammen mit seinen Manuskripten. Er lebt heute als Vertriebener in Georgien. Viele seiner Erzählungen erschienen in russischer Übersetzung in der St. Petersburger Literaturzeitschrift Newa und in Kreschatiki. Er ist in Georgien mit verschiedenen Literaturpreisen ausgezeichnet worden.

Zu Tschkwanawas literarischen Vorbildern zählt Ernest Hemingway. In der georgischen Literatur selbst hat er keine Vorgänger. Anders als etwa Arkadi Babtschenko, mit dem er verglichen werden könnte, beschreibt Tschkwanawa nicht das Leben der Soldaten, sondern das Leben der Zivilisten, die nie richtige Soldaten geworden sind.
Auf Deutsch erschienen: „Unerledigte Geschichten“ (übersetzt von Susanne Kihm und Nikolos Lomtadse), Roman, Voland & Quist 2018.
Werke
Koloritebi (Bunte Vögel), Episodenroman, 380 S., Diogene 2004. SABA-Preis für das beste literarische Debüt des Jahrs 2004.
„Koloritebi“ besteht aus mehreren Erzählungen, die alle gemeinsame ProtagonistInnen und einen inneren Zusammenhang haben. Geschichte um Geschichte entsteht ein ironisch gefärbtes literarisches Puzzle-Spiel um Liebe, Hass, Tod und Armut, Freundschaft, Sehnsüchte und Wünsche. Schauplatz ist Sochumi am Schwarzen Meer, die Personen an Kaleidoskop von Stadtoriginalen, Kleinkriminellen, Bonzen, rachsüchtigen Frauen und und … Beispielhaft für die Erzähltechnik des Autors kann die Geschichte des Briefträgers genannt werden: In „Die Rache der Daredschan Kwarazchelia“ hat er eine kleine Rolle, er verteilt lediglich die Zeitungen. Die weiteren Geschichten beschreiben sein Leben, seine Persönlichkeit; man bemerkt, dass der Sohn des Briefträgers auch der Erzähler ist. Eine andere zentrale Figur ist Raschiko Kesua. In einer der Erzählungen wird berichtet, dass er mehrere Ehefrauen hatte. In einer anderen beschreibt der Autor, wie Raschiko Kesua es schaffte, viermal zu heiraten und trotzdem allein zu bleiben. Dieses Aufbauverfahren wendet der Autor konsequent an, sodass Bild für Bild sich allmählich ein exotischer Kosmos vor dem Leser ausbreitet.
Toreadorebi (Toreros), Roman (zweisprachig russisch-georgisch), 220 S., Diogene 2006
Ein paar junge Männer verfolgen einen realen, aber unkonventionellen Feind – ist es wirklich ein Feind? Sie verlieren ihr Leben – wofür? Gela Tschkwanawa kennt die lokalen Konflikte aus eigener Erfahrung. Er beschreibt die Kriegssituation überaus präzise (wahrscheinlich den Konflikt in Abchasien 1992-1993; die fehlenden Zeitangaben spielen auf die Allgegenwart des Krieges an). Lakonisch und sparsam schildert er Atmosphäre und Gemütsverfassungen, wobei der Alltag der Menschen im Vordergrund steht: die Suche nach Essen, nach Schutz und nicht zuletzt nach seelischem Frieden und Ruhe, selbst wenn sie nur einige Minuten dauern. Darüber hinaus Freundschaft, Überlebensdrang und Hilfsbereitschaft. Denn es geht um die Wahrung der Menschlichkeit, die Wahrung der Persönlichkeit und des Stolzes, sich Mensch nennen zu dürfen, selbst unter extremen Bedingungen.
Russische und englische Übersetzung verfügbar
mehr über Toreros
Daumtawrebeli ambawi (Unerledigte Geschichten), Kurzer Roman und 8 Erzählungen, 280 S., Diogene 2008
„Unerledigte Geschichten“ besteht aus dem gleichnamigen kurzen Roman (129 S.), auf Deutsch erschienen 2018 bei Voland & Quist, und 8 Erzählungen. Die Erzählungen sind das Psychogramm einer Gesellschaft im Krieg. Die Kämpfer sind keine Berufssoldaten, sondern Zivilisten, die aus Überdruss, Verzweiflung, Neugier, Langeweile, Freundschaft oder Verwandtschaft in den Krieg ziehen. Diese Halbsoldaten-Halbzivilisten kämpfen in der Nähe ihrer Wohnorte und gehen abends mal oder am Wochenende Verwandte besuchen. Der Krieg scheint für die Gemeinschaft eine neue Beschäftigung zu sein, dessen Gesetz aber die sozialen Gesetze verändert. Verwandtschaft (wie in der Erzählung „Der Schwager“), alte Freundschaften und Feindschaften („Die Diplomaten“), Liebe und Hass („Der Moskwitsch meines Vaters etc.“) gewinnen mit dem Krieg eine neue Qualität. So sieht sich der Icherzähler in „Sag mir, dass alles in Ordnung ist“, der in der Einheit seines Schwagers kämpft, gezwungen, der Verwandtschaft eines gefallenen Mitkämpfers zu beweisen, dass er, nur weil er überlebt hat, nicht an dessen Tod schuldig war. In diesem Krieg scheint jeder auf die gesellschaftliche Absolution angewiesen zu sein.
Tschkwanawa gelingt es, sowohl ein eindrucksvolles literarisches Zeugnis des Abchasienkriegs zu geben als auch ein präzises und vielschichtiges Bild einer vom Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Gesellschaft zu zeichnen. Die Handlung findet im Zwischenraum zwischen Altem und noch nicht eingekehrtem Neuen statt. Damit gelingt es Tschkwanawa, über die Beschreibung des lokalen Konfliktes hinaus dem Moment der Veränderung im gesamten postsowjetischen Raum auf die Spur zu kommen.
mehr über Unerledigte Geschichten
Leseprobe „Die Diplomaten“
Sodgareneli Sch., 4 Erzählungen, 204 S., Diogene 2012
„Der Jäger“, „Sodgareneli Sch.“, „Auf der Datscha“ und „Niko“ sind vollkommen anders als Tschkwanawas bisherige Erzählungen. Die ganze Sammlung baut auf Spannungseffekten auf. Märchenhaftes und reale Welt greifen ineinander. Dramatische Episoden wechseln ins Komisch-Skurrile. Allen gemeinsam ist, dass sie von tragischen Geschehnissen erzählen, die den oft naiven und abergläubischen Protagonisten direkt oder indirekt treffen. Die Dörfer oder ländlichen Kleinstädte mit Seen, Meer und Berglandschaften lassen sich als das Umland der Schwarzmeerküste identifizieren, eine bunte Welt am Rand. Plastisch und zugleich fern und unwirklich ist diese Welt, in der archaische Regeln gelten, die noch von den Geistern der Ahnen bevölkert ist und die parallel zu dem immer mehr vordringenden modernen Leben fortbesteht. Die Protagonisten geraten immer wieder mit der Lebensart des städtischen Milieus in Konflikt. Die Gemeinschaft und auch ihre Toten üben immer noch Macht aus. Wie auf den Jäger Kakkuba, der aus Eifersucht seine Frau umbringt und den Rivalen in eine tödliche Falle locken will, ihr aber selbst zum Opfer fällt.
Tschiantschwelebi (Ameisen), 13 Erzählungen, 260 S., Diogene 2012
Der Band enthält Erzählungen, die Tschkwanawa in den letzten zwei Jahrzehnten geschrieben hat und die auf die eine oder andere Weise das Thema „Schicksal” aufgreifen. Sie stehen zwar für sich, aber es entsteht im Ganzen eine dichte fiktive Welt. Nicht nur die Schilderung einer Gesellschaft im Umbruch der Nachkriegszeit, zwischen Nicht-Mehr und Noch-Nicht, erzeugt diesen Eindruck, sondern auch das Phänomen der schicksalhaften Fügungen, welches der Autor in den verschiedenen Geschichten evoziert. (Das Leben geht mit den Menschen wie mit Ameisen um und zerdrückt sie.) Böse Omen, Vorahnungen, Träume sind lebendig inmitten der nüchternen und zuweilen brutalen Welt von Tschkwanawas Protagonisten. Die Geschichten sind dabei geradezu unerbittlich lebensnah und realistisch und schlagen den Leser von Beginn an in Bann. Vieles steht zwischen den Zeilen, das Ungesagte zeichnet diese Prosa aus und lädt die Lektüre mit melancholischer Spannung auf, erzeugt eine Sehnsucht nach Befreiung. Aufatmen gestattet uns der Autor aber in den wenigsten Geschichten, etwa in jener sehr atmosphärischen über einen Klavierstuhl: Erst von einem Kleptomanen gestohlen, dann im Garten des taubstummen Nachbarn wiederentdeckt, ist er Grund für Missverständnisse, bis er schließlich, wenn vielleicht auch nur vorübergehend, Versöhnung und Erleichterung bringt.
Ase (So), Roman, 124 S., Diogene 2013
Ein spannungsgeladener und beunruhigender phantastischer Roman. Er spielt in der Welt menschengroßer Ratten, die menschliche Siedlungen überfallen und die Menschen versklaven. Darunter sind die beiden Männer Akaprzcha und Natschitscha. Sie stammen aus demselben Dorf, waren aber verfeindet und kommen sich auch in der Gefangenschaft kaum näher. Eine wichtige Rolle in der Rattengemeinschaft spielt das Mitosumapa-Fest, ein Paarungs- und Fruchtbarkeitskult. Akaprzcha erlernt die Rattensprache, die sich auf Piepslaute, „Lesen” von Ausscheidungen und Gesten gründet. Heimlich schreibt er die Chronik seiner Gefangenschaft auf Tontafeln nieder, Sentenzen über Leben und Tod, aber auch die Geschichte des Rattenvolks, das von seinem König zunehmend diktatorisch regiert wird. Akaprzcha befördert das noch, indem er riesige Tonskulpturen anfertigt, die einen wahren Kult begründen und ihm eine privilegierte Stellung verschaffen. Nach seinem Tod werden die Tontafeln entdeckt; viel später gelingt es einer Rättin, sie zu entziffern; sie wird zur Begründerin der Schriftlichkeit im Rattenreich. Der Roman kann als politische Parodie auf konkrete Entwicklungen in bestimmten Ländern gelesen werden, aber er ist auch die allegorische Darstellung einer totalitären Gesellschaft.